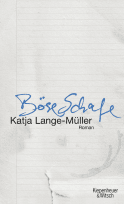Katja Lange-Müller erhält Thomas-Mann-Preis 2025

Katja Lange-Müller erhält den diesjährigen Thomas-Mann-Preis für ihr erzählerisches Werk, das in einer unverwechselbaren Mischung von grotesker Komik und Melancholie literarische Verhaltensforschung betreibt: an Menschen, Tieren und Pflanzen.
Begründung der Jury
"Seit ihrem Debüt Wehleid – wie im Leben von 1986 hat die 1951 in Ost-Berlin geborene Katja Lange-Müller unsere Lebenswelt in zahlreichen Romanen, Erzählungen und Prosaminiaturen ausgeleuchtet: durch scharfe Milieubeobachtungen der Vor- und Nachwendezeit (zuletzt in ihrem Roman Unser Ole, 2024), durch Einblicke in die Falltüren der Liebe (im Roman Böse Schafe, 2007) oder randständige Enklaven (in Die Letzten. Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000). Ihre Texte erzählen ohne Larmoyanz und Belehrungswahn von Außenseitern und Scheiternden in den Ausnahmezuständen des Alltags: bitterkomische
Geschichten mit einem feinen Sinn für prägnante Kürze und „zwielichtige Wortgebilde“ (Drehtür, 2016)."
Preisverleihung
Die Verleihung des Preises durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau, und den Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Winfried Nerdinger, findet am 13. November 2025 um 19 Uhr in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in der Münchener Residenz statt. Die Laudatio hält der Literaturkritiker Carsten Otte.
Über den Thomas-Mann-Preis
Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.
Dankesrede von Katja Lange-Müller zum Thomas-Mann-Preis
»Guten Abend, geschätzte Anwesende, verehrter Herr Lindenau, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, verehrter Präsident der Bayrischen Akademie der Schönen Künste Herr Nerdinger, liebe Jury, liebe Freunde, mein lieber Laudator Carsten Otte!
Oh, Thomas Mann-Preis, dachte ich hocherfreut und tief gerührt, als ich im Sommer 2024 via E-Mail erfuhr, dass die Jury beschlossen habe, mir diese ungeheure Ehre zuteilwerden zu lassen. Ungeheuer, also nicht geheuer, fürwahr, denn fast im selben Augenblick verstand ich: die Preisverleihung würde im Thomas Mann-Jahr 2025 stattfinden, ausgerechnet 2025, dem Jahr des hundertfünfzigsten Geburtstags und siebzigsten Todestags des weltberühmten Schriftstellers, in dem nochmals viele neue Publikationen zu und über ihn zu erwarten wären – und von mir natürlich eine möglichst originelle Dankesrede. Natürlich begann ich sofort Thomas Manns Werke, die ich natürlich bereits kannte, nochmals zu lesen. Dass ich das Wörtchen natürlich, das in deutschen Texten häufig und zumeist eher beiläufig als eine Art also-Synonym vorkommt, schon am Anfang meiner Rede gleich dreimal hintereinander benutze, hat, wie Sie bald hören werden, durchaus seine Berechtigung.
Ich kann und will mich nicht an oder gar mit Thomas Mann messen, das wäre nun wirklich vermessen, aber vergleichen schon, so, wie sich jede Leserin, jeder Leser, nach Maßgabe ihrer oder seiner Lebens- und Leseerfahrung bewusst oder unbewusst mit den Figuren ihrer oder seiner Lektüren vergleicht – und sogar mit dem Autor oder der Autorin selbst.
Was, fragte ich mich beklommen, haben wir wohl gemeinsam, der Mann Mann und die Frau Lange-Müller? Doch kaum mehr als eine Giraffe und ein Maulwurf. Man könnte sagen: es sind Säugetiere. Wobei völlig klar ist, wer von uns das schnelle, elegante, an jeden Zweig heranreichende Geschöpf wäre und wer der spitznasige, einzelgängerische Untergründler. Leider stören die in der deutschen Sprache recht beliebig an die Substantive vergebenen Artikel mein ohnehin schiefes Bild. Wenn schon, dann müsste es der Giraffe Thomas und die Maulwurf Katja heißen. Aber gut, wir beide – und wir alle hier – waren oder sind Vertreter der Gattung Homo sapiens, die noch immer ganz oben in der Stammbaumkrone der Schöpfung sitzt und an dem Ast sägt, von dem sie anders gar nicht mehr runterkommt, er verfasste Literatur, ich versuche das ebenfalls, er rauchte, ich rauche, er nannte Katharina, seine Gefährtin, Katja, und mein Rufname lautet so, wir haben ein ambivalentes Verhältnis zur Natur, der großen Anarchistin, ein ausgeprägtes Interesse an den Medizinischen Wissenschaften und ein Faible für präzise Recherchen und grimmige Komik…
Wie gesagt, ich las und las, auch um weitere Ähnlichkeiten zwischen Thomas Mann und mir aufzuspüren. Vielleicht, dachte ich, liegt das Ähnliche manchmal tatsächlich zwischen den Verschiedenen, sogar dann, wenn die noch leben, der eine literarisch, die andere zumindest physisch. Ich las erneut und durchaus beeindruckt Die Buddenbrooks, den Zauberberg, Doktor Faustus, das Felix Krull-Fragment, aber richtig reingewühlt habe ich mich in die Erzählungen, denn die Leidenschaft für dies kürzere, jedoch, am Roman gemessen, entschieden nachhaltigere Genre, die verbindet uns ebenfalls und weit über die anfangs erwähnten Banalitäten hinaus.
Warum sind Erzählungen in meiner Wahrnehmung nachhaltiger als Romane? Weil sie, bei den Schreibenden wie bei den Lesenden, mehr Konzentration erfordern und einen strafferen Spannungsbogen haben. Nicht jeder Roman, aber jede Erzählung, egal ob wir sie dann gelungen oder nicht so prickelnd finden, bedarf der Verdichtung, der stilistischen Raffinesse und Disziplin und provoziert daher besonders intensiv unsere Fantasie und unsere Deutungskompetenz. Wie aus Hemingways Eisberg-Theorie hervorgeht, haben Erzählungen ein Ausmaß, das man ihnen zunächst weder ansieht noch zutraut. Unter den lesbaren, sehr wohl den Text, doch eben nicht das gesamte Volumen einer Erzählung offenbarenden Wörtern verbergen sich jene, auf die wir erst nach der Lektüre stoßen, denn sie bringen Fragen mit sich, die wir uns schon selbst beantworten müssen. Wenn wir uns den Fragen stellen, die der Text uns stellt, erst dann entdecken wir die ungeschriebenen, ungesagten oder sogar unsäglichen Wörter unter dem Gelesenen, jene, um die es immer geht, wenn es um Literatur geht. Dass Erzählungen meistens vom Ende herrühren, ja, ihre Schlusssätze eigentlich die reziproken Anfänge sind, verbindet sie dramaturgisch mit dem Witz, über dessen Qualität auch immer der lakonisch knappe Erzählstil und vor allem das – möglichst überraschende – Ende entscheidet. Ein simples mathematisches Gesetz, das alle literarischen Genres betrifft, lautet: Je weniger Wörter der Text hat, umso wichtiger ist jedes einzelne; und dies gilt nicht nur für Gedichte, sondern, wie das ihm eingeschriebene Verb zählen vorgibt, auch für Er-zählungen. – Eine Mücke zum Elefanten aufzublasen, ist relativ einfach. Aber versuchen Sie mal das Umgekehrte, machen Sie aus einem Elefanten eine Mücke, die ebenso viel wiegt wie der Elefant!
Unseres gemeinsamen Faibles für die Erzählung wegen und weil mittlerweile wirklich jedes seiner Werke, jeder Brief und jede Notiz so gründlich untersucht, beleuchtet, bewertet ist, wie sein ganzes langes Leben, habe ich beschlossen, aus dem Konvolut der Thomas Mann-Erzählungen jene zutage zu befördern, die mich beschäftigt, seit ich sie zum ersten Mal las, gerade die möchte ich – sozusagen maulwurfspezifisch – aufwerfen, nicht zu einem Zauberberg, aber doch zu einem beachtlichen Hügel, seine letzte abgeschlossene Story; ja, der angloamerikanische Begriff trifft es genauer als das deutsche Wort dafür, und diese Story ist in der Thomas-Mann-Galaxie nun schon beinahe eine Shortstory.– Ich meine Die Betrogene, um die viele Kenner und Kennerinnen seiner Schriften bislang lieber einen Bogen machten, womöglich weil sie ihnen zu unheimlich war. Oh doch, gerade diese astreine Novelle, diese wahrlich „unerhörte Begebenheit“, die er in den Jahren 1952 bis 53 schrieb, also noch in Pacific Palisades begann und in der Schweiz beendete, hat, denke ich, nicht unbedingt die Würdigung erfahren, die ihr zusteht. Als sie erschien, reagierten „die mit der Lizenz zur Rezeption“ ziemlich ungehalten. Ein amerikanischer Kritiker schrieb, Die Betrogene eigne sich bestenfalls als „Geburtstagsgeschenk für Gynäkologen“; ein pikierter deutscher Kritiker befand, dass dieser Erzählung ein „Schicksal im Papierkorb“ zu wünschen gewesen wäre.
Die Idee zu seiner, die Einheit und den Kampf der Widersprüche im literarischen Gewand darstellenden, mithin durch und durch dialektischen Novelle Die Betrogene entsprang einer Anekdote über eine Frau aus Münchner Adelskreisen, die Katja Mann am Frühstückstisch erzählte. Jener Aristokratin geschah, wie Katja in ihrem Tagebuch festhielt, nahezu eins zu eins das, was Thomas Mann seiner Rosalie von Tümmler geschehen lässt. Doch der Handlungsort, befand der Autor, der seinen Arzt Dr. Rosenthal sogleich um eine medizinische Expertise bat, sollte möglichst weit von München entfernt sein; er wählte, wohl auch wegen einer emotionalen Erinnerung an einen, der aus dieser Stadt kam, Düsseldorf. Das hatte weitere Recherchen zur Folge. Wie spricht man da? Welche Mentalität ist den Rheinländern eigen? Er schreibt Briefe, lässt sich die Topografie der Düsseldorfer Villenorte, der Bergischen Landschaft und des Schlosses Benrath erläutern, will wissen, wie die Dortigen sich ausdrücken, wenn eine „in der Hoffnung ist“, und legt Rosalie wortwörtlich die von Grete Nikisch empfohlene Formulierung, „Da ist wat am Kommen“, in den Mund.
Die erlebnis- und recherchebedingte Glaubwürdigkeitsenergie und das dialektisch austarierte, dennoch spielerische Für und Wider in jedem Thomas Mann-Werk leuchten einem aber erst ein, wenn man seinerseits beginnt, deren Entstehungsgeschichten zu recherchieren. Beim Sammeln solcher Sekundärinformationen zu Thomas Mann und dem nochmal und nochmal Lesen seiner Romane, Erzählungen und Essays bemerkt man bald staunend: all das ist vielschichtig – wie Zwiebeln.
Doch genug davon, sonst verliere ich mich vollends in der Bewunderung seines und meines Fleißes beim Aufspüren von Material. Lassen Sie mich zur Betrogenen zurückkehren, jener Story, die der Germanist Hans Rudolf Vaget als Manns „bösestes“ Werk pries und die ich im Abstand etlicher Jahre drei, vier Mal gelesen und zuletzt, in Vorbereitung meiner Dankesrede, regelrecht studiert habe.
Beim ersten Lesen, da war ich etwa dreißig, hat mich Die Betrogene irritiert. Ach, dachte ich, Thomas Mann erzählt diesmal eher personal als auktorial und begibt sich, was ich so von ihm noch nicht kannte, in die Gemütslage, Gedankenwelt und Physiologie einer Frau, nein, sogar zweier Frauen, einer älteren und einer jungen, die er allerdings beide ein bisschen auf die Schippe nimmt, und noch deutlicher Ken, den dritten im diesem Protagonisten-Dreieck. Ab den letzten dreißig Seiten überwog sogar der Eindruck, nicht die Natur, die eben auch abgründige Facetten hat, sondern der Autor selbst täuscht die arme Rosalie derart fatal. Er, Thomas Mann, bringt sie um ihr schon zum Greifen nahes spätes Glück und lässt sie eines bizarren, grauenvollen Todes sterben. Am Ende war ich erschrocken und irgendwie peinlich berührt, wie die meisten Frauen, die ich nach ihrer Lektüreerfahrung mit der Betrogenen fragte. „Unfaire, dämonische Geschichte“, sagte eine Schriftstellerfreundin, „aber losgelassen hat sie mich nie“.
Halt, an der Stelle jetzt will ich uns diese zwischen parodistischer Groteske und Tragödie changierende Story möglichst kurz in Erinnerung rufen, obwohl ich sicher bin, dass die meisten von Ihnen sie so gut kennen wie mittlerweile auch ich. Und schauen Sie sich bitte mal an, wie Thomas Mann die Natur sah in einer Karikatur für Schwester Clara aus dem Jahr 1897.
Ja, das Peinliche, gerade das hat den 1952 schon recht alten Schriftsteller offenbar enorm gereizt. War er am Ende so frei, dass er um nichts Peinliches mehr verlegen war? „Wirf dein Kreuz ab und alles ist dein“, heißt es bei Heiner Müller. Im hohen Alter, konstatiert Hans Rudolf Vaget, der den Kommentarteil zu den Erzählungen von 1919 bis 1953 schrieb, hat sich der formbewusste Thomas Mann bemerkenswert locker gemacht und ein „souveräneres, keckeres Verhältnis zur Sexualität gewonnen“.
Worum geht es: In den Zwanzigerjahren überkommt die etwa fünfzigjährige, wohlhabende Rosalie von Tümmler – plötzlich und unerwartet, wie es in Todesanzeigen gerne heißt – das erotische Begehren. Für ihren Gatten, einen nicht auf dem „Felde der Ehre gefallenen“, sondern pikanterweise bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Oberstleutnant, dem der Nachname von Tümmler auch außerhalb des Ehebetts Programm gewesen ist, hatte sie dergleichen nie empfunden. Doch nun, jenseits des Klimakteriums, ergreift sie die Liebe, heftig, wie ein seltsamerweise angenehmer, fiebriger Infekt. Sie vernarrt sich, praktisch von einem Tag auf den nächsten, in den halb so alten, breitschultrigen, schmalhüftigen, ganz nett aus seinen lässigen Klamotten schauenden US-Amerikaner Ken Keaton, den Englisch-Nachhilfelehrer ihres rothaarigen und auch sonst eher dem Vater ähnelnden Söhnchens Eduard. Ken ist – trotz seiner durchtrainierten Erscheinung – wie alle Begehrten bei Thomas Mann, kein Unversehrter; er verlor im ersten Weltkrieg eine Niere, bezieht, neben dem Gehalt für seine Dienste an Eduard, eine kleine Invalidenrente und mag Europa unpatriotischerweise mehr als sein Vaterland. – Namen sind bei Mann ja nie Schall und Rauch, sondern poetisch-wesensmerkmalhafter Bestandteil seiner Literatur. Der Kerl heißt Ken, wie der Mann von Barbie, was Thomas Mann nicht wissen konnte, uns Heutigen jedoch sofort in den Sinn kommt, zumal diese Plastikpuppe aussieht, als habe die US-Firma Mattel, der die Rechte an Barbie und Ken gehören, sie nach Manns Beschreibung designt. Und er heißt Keaton, wie der Schauspieler und Komiker, dessen Rufname Buster lautete. Der ging als „Mann, der niemals lachte“ in die Geschichte des Kinos ein und wurde ausgerechnet mit dem Stummfilm Der General berühmt; ja, solche Scherze mochte unser Maitre. Auch der Name Rosalie passt bestens, denn die adrette Matrone wurde im Wonne- und Rosenmonat Mai geboren und pflegt ein schwärmerisches Verhältnis zu ihrer, wie sie schließlich ohne grimm erkennen wird, äußerst launischen und manchmal eben sehr schlecht gelaunten „Mutter Natur“, und sie war, bis zu ihrem schauerlichen Tode, auch selbst eine echte – geistigen Getränken und Gesprächen nicht abgeneigte – rheinische Frohnatur. Ihr Widerpart ist Anna, die erwachsene, mit einem Klumpfuß zur Welt gekommene, daher dem männlichen Geschlecht gegenüber verschlossene und von einem, der ihr halbherzig den Hof machte, herb enttäuschte Künstlerin. Sie hat an der Akademie studiert, malt abstrakte Bilder, ist intelligent, aber im Unterschied zur Mutter gar nicht abenteuer- oder wenigstens unternehmungslustig. Rosalie und Anna führen kultivierte, rhetorisch brillante, dennoch vertrauliche Gespräche über die Natur, die Kunst, religiöse und moralische Themen und nicht zuletzt über Rosalies Schwäche für Ken, die Anna allerdings äußerst unschicklich findet. Anfangs traut sich Rosalie noch nicht so recht aus der Deckung; da sie ihre fruchtbare Zeit hinter sich hat, fühlt sich nicht mehr als vollwertiges Weib, sondern, Zitat, „nur noch die vertrocknete Hülle von einem solchen, verbraucht, untauglich, ausgeschieden aus der Natur“. Doch bald erneuert sich, sozusagen aus heiterem Himmel, ihre Periode. Die gütige Natur, im Bunde mit erotischer Leidenschaft, glaubt sie, habe ihr ,,das Verlorene“ zurückgegeben. „Triumph, Anna, Triumph, es ist mir wiedergekehrt (…) nach so langer Unterbrechung, in voller Natürlichkeit und ganz wie es sich schickt für eine reife, lebendige Frau“. Nun ist Rosalie würdig „der Mannesjugend“, die es ihr „angetan hat“, und braucht nicht mehr scheu „die Augen niederzuschlagen“. (…) „Bei all deiner Distanz zum Liebensleben“, weist sie Anna zurecht, „wird dir nicht unbekannt sein, daß junge Leute sehr oft eine gereifte Weiblichkeit der unerfahrenen Jugend, dem blöden Gänschentyp vorziehen“. Frau von Tümmler ignoriert alle Ermahnungen der Tochter, die sich ob der Schamlosigkeit ihrer Mutter in Grund und Boden schämt, ordnet einen Ausflug zu viert an – und den nutzt sie: Allein mit Ken in einem „Geheimgang“, gesteht Rosalie dem nicht Abgeneigten ihre Gefühle. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag; in seiner Stube soll es endlich zum Äußersten kommen. Doch „Frau von Tümmler kam nicht zu Ken Keaton“. In der Nacht nach dem Ausflug befällt sie „schwere Unpässlichkeit“; sie erleidet einen Blutsturz, verliert vorübergehend das Bewusstsein und stirbt schließlich an einem Uteruskarzinom. – Das hat Thomas Mann mit Heinrich von Kleist gemeinsam, es kommt nie zum Äußersten. Mal stirbt vorher die oder der eine Liebende, mal die oder der andere, bei Kleist auch mal beide.
Nun ja, während des ersten Lesens bewegt man sich noch über die Haut der Geschichte, folgt dem Spannungsbogen, will wissen, wie das ausgeht. Beim zweiten Mal legt man schon die Schicht unter der Epidermis frei, die Dermis also, in der sich die Nerven und die feinen Blutgefäße befinden, und entdeckt das stringent-dialektische Für-und-Wider, das Schwarz und Weiß, das Hell- und Dunkelgrau, das die Menschen, deren Verhältnisse und auch die Natur immerfort bewegt, verändert und – differenziert – wiederholt. In der Betrogenen betreibt Thomas Mann dieses Dialektik-Spiel wie ein Schachspiel mit oder gegen sich selbst. Rosalie, Anna und Ken sind seine Figuren, aber so ganz mag er sie nicht beherrschen, vielleicht nicht mehr. Zunächst tanzen die Drei noch nach der Pfeife des Autors, indem sie ebenfalls subtil mit- und gegeneinander kämpfen. Doch bald erkämpfen sie sich auch ein Eigenleben, einen eigenen Willen – und Unwillen. Fazit: das Antagonistische an und in den Menschen und den ihnen nachgeformten Protagonisten ist für den späten Mann nicht weniger anregend als deren Gemeinsamkeiten – und das einzige primäre Geschlechtsmerkmal aller Menschenwesen, der echten wie der literarischen, war, ist und bleibt: das Menschliche – mit all seinen Stärken und Schwächen.
„Viele Interpreten“, schreibt die Germanistin Henriette Herwig, „haben in Rosalies Tabubruch nur die weibliche Maske gesehen, hinter der Thomas Mann seine Todesangst und die verdrängten homoerotischen Passionen seines eigenen Lebens verborgen habe. (…) Wenn Die Betrogene eine weibliche Maske des Autors ist, dann in zweierlei Gestalt: Rosalie mit ihrem sinnenfreudigen, gefühlsbetonten Leben steht Anna als Inbegriff von moderner Kunst, Vernunft und Sittlichkeit gegenüber, der Naturschwärmerin die kontrollierte, selbstdisziplinierte, zur Abstraktion neigende Künstlerin. Beide verkörpern Lebensprinzipien des Autors“. – Und eben das Antagonistische, muss ich hinzufügen. Rosalies Göttin ist, was an Blasphemie grenzt, die alles Organische umfassende Natur. Diese Frau von Tümmler ist, wie Mann vorgibt, „einfachen Gemüts“, kennt sich aber mit der Bibel und der griechischen Mythologie bestens aus. Sie weiß, die Natur ist nicht nur bewundernswert schön, sondern auch selbstsüchtig, unberechenbar, rücksichts- und zügellos. Warum sollte sie, das reife Naturkind, denn nicht mal ebenso sein, bevor ihr Leben als ein Mensch endet und ihre sterblichen Überreste den Rosenstock auf ihrem Grab nähren?! Liebe macht, wer wüsste es besser als Thomas Mann, blind, betäubt den Verstand, verleitet zu Fehldeutungen. Liebe, wie Rosalie sie versteht, ist im Grunde ja gar nicht natürlich! Tiere und Pflanzen verlieben sich nicht, die vermehren sich bloß. – Ihr Widerpart Anna ist klug und gebildet, aber deren Kunst und deren Weltbild sind dogmatisch, abstrakt, irgendwie kalt. Für Rosalie, die einmal spöttisch wünscht, die Tochter möge doch, wenn ihr Blumenstillleben zu banal sind, versuchen, Düfte zu malen, ist die angebliche Liebe ihrer Tochter zur Kunst allzu künstlich, also nicht echt, nicht wahr. Je ungehemmter die Ältere sich die Freiheit nimmt, real zu lieben, mit allen Sinnen und ihrem Körper, umso konservativer, ja spießiger reagiert die Junge. Anna, die unter heftigen Regelschmerzen leidet, hat ihre Mutter darum beneidet, dass die „das Monatliche“ nicht mehr ertragen musste. Rosalie jedoch freut sich unbändig über die Rückkehr dessen, was sie für die Mensis hält – und ein Privileg des Weiblichen in der generell feminin dominierten Natur. Dass sie gebären können, zeichnet die Frauen vor den Männern aus; es ist wichtiger als die Fähigkeit zu zeugen, daran glaubt Rosalie felsenfest. Der Krokus verkündet den Frühling, die ihm gleichende Herbstzeitlose das Ende des Sommers, aber giftig sind sie beide. - Ich könnte nun noch lange damit fortfahren, das widersprüchlich einander Verbundene anhand der weiteren Novellen-Figuren aufzuzeigen, doch dann würde diese Dankesrede gewaltig ausufern, und das möchte ich Ihnen nicht zumuten.
Beim dritten und vierten Wiederlesen fiel mir Thomas Manns gewandeltes Verhältnis zu den USA und den Amerikanern auf und wie er Rosalie, wohl nicht nur wegen ihrer – von ihm, dem Autor – verordneten Schwärmerei für Ken und dessen Sprache, die heile Düsseldorfer Adelswelt bedrohende Gedanken in den Kopf und „unschickliche“ Worte in den Mund legt. Betrauert und feiert er so den Abschied von jenem Teil des amerikanischen Kontinents, dessen Staatsbürger er geworden ist? Eindeutig Ja. Auch seine kenntnisreich-bitteren Erfahrungen mit der Ratlosigkeit, der Hierarchiehörigkeit, der Distanz und Arroganz der Ärzteschaft lässt er einfließen ins letzte Drittel dieser Novelle, die seine Heldin um die Erfüllung ihrer Wünsche betrügt und dennoch eine, was die zwei Mediziner betrifft, parodistische Glanzleistung ihres erstaunlicherweise immer stärker mit Rosalie fühlenden Erfinders ist. – Nie wollte sich Thomas Mann in seine Figuren verlieben, das ging ihm gegen die Natur der Literatur. Doch die heiter-eigensinnige, mutig ihrem Begehren folgende Rosalie, die eben darum nicht unbedingt das weibliche Pendent zu Gustav von Aschenbach in der Parallel-Novelle Der Tod in Venedig ist, die wuchs ihm offenbar während des Schreibens viel mehr ans Herz als der greise, voyeuristische Schwerenöter mit dem schwarz gefärbten Haar. Die Offizierswitwe gerät ihm zu einer nicht gerade frühfeministischen, doch ganz gewiss frühgrünen, eben nicht naiven, sondern lebensklugen Frau, die sich demokratischer Gesinnung öffnet und zuletzt die ambivalent-anarchistische Natur der Natur begreift und billigt. Auf dem Sterbebett obsiegt diese sanfte Tollkühne – selbst über jene Niederlage, die ihr von der gemeinen Seite ihrer hochverehrten heidnischen Göttin zugefügt wurde, und das mit wahrhaft philosophischem Gleichmut!
„Anna“, sagt Rosalie mit verlöschendem Atem „sprich nicht von Betrug und Grausamkeit der Natur. Schmäle nicht mit ihr, wie ich es nicht tue. Ungern geh ich dahin – von euch, vom Leben, vom Frühling. Aber wie wäre denn Frühling ohne den Tod? Ist ja doch der Tod ein großes Mittel des Lebens, und wenn er für mich die Gestalt lieh von Auferstehung und Liebeslust, so war das nicht Lug, sondern Güte und Gnade.“
Ja, „Güte und Gnade“ lässt auch der Autor seiner Rosalie angedeihen, indem er ihr die sexuelle Vereinigung mit Ken erspart. Denn so, wie er diesen Sonnyboy gestrickt hat, arglos-unbeholfen, gern viel Bier trinkend und eher an deutscher Geschichte als an Weibergeschichten interessiert, wäre der von Rosalie ersehnte Coitus sicher kein Happyend geworden, sondern eine herbe Enttäuschung, für sie – und womöglich auch für uns Leserrinnen und Leser.
Ich könnte jetzt noch die Resultate meiner vierten Lesart, also die Subcutis dieser mehrhäutigen Geschichte vor Ihnen ausbreiten, ihre olfaktorischen, mythologischen und gesellschaftsanalytischen Aspekte erläutern, mich dem Rhythmus widmen, den Farben, der Architektur und Temperatur, die, je nach Blickwinkel, immer anders und neu wirken. Aber wir haben nicht ewig Zeit, und ich verspüre das Bedürfnis nach einer Zigarette. Doch wenn mir irgendwann nichts Eigenes mehr einfallen sollte, vielleicht schreibe dann auch ich mal ein opulentes sekundärliterarisches Buch – über Die Betrogene.
Geschätzte Anwesende, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die ich nun lange genug strapaziert habe. Ich danke der Jury für den Thomas Mann Preis des Jahres 2025 und meinem Laudator Carsten Otte dafür, dass er sich so wohlwollend mit meinem – an Thomas Mann gemessen bescheidenen – Werk auseinander- und wieder zusammengesetzt hat.«