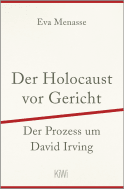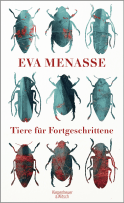Eva Menasse erhält Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels

Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse ist diesjährige Preisträgerin des Ehrenpreises des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln, wie von Benedikt Föger, dem Präsidenten des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, bei einem Mediengespräch am 4. September verlautbart wurde. Der Ehrenpreis ist die höchste Auszeichnung, die der österreichische Buchhandel zu vergeben hat. Er wird seit 1990 an Personen vergeben, die sich in ihrem Werk und durch ihr Engagement für Toleranz in Bezug auf sprachliche sowie kulturelle Vielfalt in herausragender Art und Weise eingesetzt haben und somit einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in Europa geleistet haben.
Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels ausgerichtet.
Begründung der Jury
„Die Autorin Eva Menasse wird im Jahr 2025 mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet. Sie steht mit ihrem Einsatz für Meinungsfreiheit und offenen Diskurs und mit ihrem kreativen Schaffen konsequent und eindrucksvoll für den kritischen Blick, für Aufklärung und aktives gesellschaftliches Engagement.
Eva Menasse ist ein Mensch mit Haltung - im besten Sinne dieses oft überstrapazierten Begriffs. Mit analytischer Schärfe und, wie es in einer Laudatio auf sie so trefflich geheißen hat, mit Unbestechlichkeit, moralischer Integrität und feinem literarischen Gespür widmet sie sich Grundfragen des demokratischen Miteinanders: dem Umgang mit Geschichte, der Macht des Erinnerns, dem Einfluss von Sprache, der Gefahr von Ausgrenzung und der Bedeutung einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Bereits mit ihrem literarischen Debüt „Vienna" (2005) gelang es ihr eindrucksvoll, persönliche Biografie und kollektive Erinnerung miteinander zu verweben. Auch in späteren Werken wie „Quasikristalle" (2013) oder „Dunkelblum" (2021), ein Roman über das kollektive Schweigen rund um ein Kriegsverbrechen, zeigt sich Menasses herausragende Fähigkeit, komplexe gesellschaftliche Prozesse literarisch anspruchsvoll zu fassen.
Menasses Engagement endet nicht bei ihrer literarischen, essayistischen und journalistischen Arbeit, ihre Haltung manifestiert sich auch ganz konkret in ihrem persönlichen Handeln. Dieses ist von dem Streben nach Toleranz, Meinungsfreiheit und kritischer Reflexion geleitet, wie bei ihrer politischen Positionierung in kritischen Momenten und beispielsweise bei der Gründung des PEN Berlin 2022, deren erste Vorsitzende sie war.
Mit der Verleihung des Ehrenpreises für Toleranz in Denken und Handeln ehrt der Österreichische Buchhandel eine herausragende Schriftstellerin und eine wichtige öffentliche Intellektuelle. In Zeiten wachsender Polarisierung, politischer Vereinfachung und aggressiver Diskurse erhebt Eva Menasse ihre unverkennbare Stimme - differenziert, unbequem und präzise", begründet HVB-Präsident Benedikt Föger den Entscheid der Jury.
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, lebt seit 25 Jahren in Berlin. Sie debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman „Vienna". Es folgten Romane und Erzählungen („Lässliche Todsünden", „Quasikristalle", „Tiere für Fortgeschrittene"), die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Preise (Auswahl): Heinrich-Böll-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis, Jonathan-Swift-Preis, Österreichischer Buchpreis, Bruno-Kreisky-Preis, Jakob-Wassermann-Preis und das Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Eva Menasse betätigt sich
zunehmend auch als Essayistin und erhielt dafür 2019 den Ludwig-Börne-Preis. Ihr letzter Roman ,,Dunkelblum" war ein Bestseller und wurde in 9 Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien der Buchessay „Alles und nichts sagen. Zum Zustand der Debatte in der Digitalmoderne".