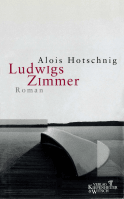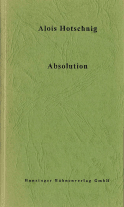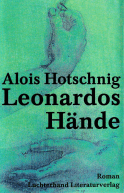Alois Hotschnig: Antrittsrede zum Mainzer Stadtschreiber 2023
Am 24. März 2023 wurde Alois Hotschnig offiziell in sein Amt als 38. Mainzer Stadtschreiber eingeführt. Wir dokumentieren seine Antrittsrede.

Die Vor-Freude auf einen Ort, an dem man willkommen ist, an den man eingeladen ist und an dem man willkommen geheißen wird, wie ich jetzt hier bei Ihnen in Mainz, diese Vorfreude ist nun schon seit einigen Tagen zur Freude über das Ankommen geworden, über das Landen sozusagen, über das erste freundliche Abtasten hinaus. Und: Der Boden trägt, merke ich, so fühlt es sich immerhin an, die Schwerkraft scheint nicht größer, ja im Moment sogar weniger fühlbar zu sein als an dem Ort, von dem aus ich die Reise zu Ihnen angetreten habe.
Die Tatsache, dass ich hier die Möglichkeit eines Immer wieder Ankommens und eines Bleibens habe für ein ganzes Jahr, macht mich dankbar und lässt mich an die unzähligen Menschen denken, die nach dem Verlust ihrer Heimat gerade keinen Ort mehr haben, der ihnen eine Heimstatt sein kann. Die „auf dem Weg“ sind, und denen die jeweilige Stufe, auf die sie den Fuß setzen, immer wieder von neuem wegbricht.
Ankommen-Können ist ein Geschenk.
Als eine kleine Warnung vorweg, aber eben auch als ein Angebot: Für die Recherche des Erzählbands „Im Sitzen läuft es sich besser davon“ habe ich mich in öffentliche Parks gesetzt, in Arzt-Praxen und in Wartezimmer jeder Art, in die Straßenbahn, in Museen, und habe mich im wortwörtlichen Sinne befruchten lassen von den Gesprächen und von den Sätzen der anderen. Rechnen Sie also bitte damit, dass Sie mich von nun an auch hier in Mainz gelegentlich auf mehr und auch weniger öffentlichen Plätzen antreffen könnten, hier möchte ich auf Empfang sein, um ins Gespräch zu kommen. Ich habe vor, mich auf diesen Ort, auf diese Stadt einzulassen.
Mit meiner gesamten Vergangenheit komme ich nach Mainz, und auch meine ungeteilte Gegenwart habe ich im Gepäck. Und freue mich auf das, was wird. Ich möchte ein Echo-Raum sein für all das, was mir an Begegnung in dieser Zeit möglich ist.
Das ist mir immer noch eine Lust, die ich unter dem Küchentisch meiner Kindheit und hinter der vorgehaltenen Tür entwickelt habe. Diese Lust, eine Geschichte weiter zu denken, neu zu überdenken und umzudenken und immer so fort. So könnte es gewesen sein, so könnte es auch gewesen sein, und vor allem: so könnte es werden.
Unter dem Tisch in der Küche lag ich und hörte den anderen zu, und wartete, wie die Gespräche der Erwachsenen sich entwickeln würden. Wenn die Erwachsenen redeten, hatten die Kinder still zu sein, und am sichersten war es, unentdeckt und also ungestört auf Empfang zu sein.
Auch hinter der Tür, hinter vorgehaltener Tür sozusagen, war so ein Ort, ich hielt mich versteckt, denn durch meine scheinbare Abwesenheit kam es seltener zu diesen abrupten „Abbrüchen“ im Gespräch. Das Mithören der Reden, die sozusagen hinter vorgehaltener Hand gesagt wurden, faszinierte mich, und das Spannendste war das Unausgesprochene in ihrem Reden. Die Gespräche der Eltern und ihrer Freunde wurden nämlich häufig abgebrochen, unvermittelt, und oft mit dem Satz: „und dann sind die Nazis gekommen.“ Meist ist es ganz still geworden danach. Das habe ich damals realisiert, diesen Abbruch der Gespräche inmitten einer Geschichte, auf den ich mir keinen Reim machen konnte. Und doch: Meine Fantasie war geweckt. Dieses Schweigen hat mich zum Lesen gebracht. In den Büchern habe ich Menschen getroffen, die reden wollten, auch über das Schweigen der anderen. An die habe ich mich fortan gehalten. Und dann, mit der Zeit ist das Lesen zum Schreiben geworden. Denn wir schreiben ja mit, wenn sich etwas einschreibt in uns.
Beobachten. Hören. Hörbar machen ‒ wie es der Komponist Gavin Bryars getan hat. „Jesus’ Blood never failed me yet“ heißt die Komposition.
Ein Obdachloser in London, der beim Casting für eine Filmmusik-Aufnahme gar nicht wahrgenommen wurde am Set, hatte dieses alte Kirchenlied vor sich hingesungen und war wieder verschwunden, unsichtbar im Chor der geschäftigen Solisten ringsum.
Und doch war es seine Stimme, die Gavin Bryars Jahre später beim Abhören der nicht verwendeten Aufnahmen heraushörte als die einzige tatsächlich relevante und berührende Stimme, für die er dann seine Komposition um das Lied des alten Mannes herum arrangierte, zu einer Zeit, als es diesen Menschen schon nicht mehr gab.
Dieser Obdachlose, der auf so zurückgenommene und doch präsente Weise still vor sich hin singt, in sich hinein eigentlich, in einer Innigkeit, wie sie mir im Leben sonst nicht begegnet ist, „Jesus’ Blood never failed me yet / Never failed me yet / There’s one thing I know / For he loves me so“, diese paar Worte, immer wieder und wieder von Neuem, in der eigentümlich gebrochenen und doch so sicheren Stimme dieses alten Mannes sind es, die mich nun schon seit vielen Jahren begleiten, und mir dabei ein unscheinbares Leben spürbar machen, als ginge es um mein eigenes Leben.
Auf Begegnungen dieser Art hoffe ich – auch hier in Mainz.
Über das Reden ins Leben kommen – ins eigene und ins Leben der andern; dem Schweigen von damals durch das Miteinander-Reden die Stirn bieten: Lichtungen in den dichten Wald des Vergessens schlagen – ich denke, auch das ist eine Aufgabe des Schreibens.
Sagen, was ist. Weitersagen. Umgehen mit dem, was bis dahin mit mir umgegangen ist. Dem Hindernis einen Sinn geben, den Sinn, dieses Hindernis zu überwinden oder zumindest zu wachsen daran.
Literatur will sich mitteilen, sie will ansprechen und überzeugen.
Doch wer ist es, der mir eine Geschichte erzählt, warum tut er das, mit welchem Motiv? Nicht immer lässt sich das eindeutig sagen, auch im eigenen Zusammenhang nicht. Im Märchen Schneewittchen sagt der Spiegel der bösen Stiefmutter die „Wahrheit“. Aber wer ist das, dieser Spiegel? Auch im Spiegelkabinett meiner eigenen Sätze stelle ich mir diese Fragen. Mein Misstrauen dem Erzähler gegenüber hat dazu geführt, dass ich Geschichten geschrieben habe, in denen es keinen Erzähler mehr gibt. Die sprechenden Personen bewegen sich darin ohne die verbindenden Sätze eines Erzählers. Aber die dahinterstehende Frage bleibt freilich bestehen und ist jedes Mal wieder aufs Neue zu stellen: Wer spricht? Denn es gibt Gründe für das Schreiben einer bestimmten Geschichte, und auch unkommentiertes Sprechen ist motiviert.
Die Welt ist eng geworden. Mit unseren Teleskopen schauen wir beinahe bis zum Urknall zurück. Doch je grenzenloser der Ausblick ist, desto enger werden scheinbar die Grenzen um uns herum und in uns.
Mit den Zäunen, die wir wieder aufstellen, sperren wir nicht nur „die anderen“ aus, wir sperren uns selbst damit ein. Wie umgehen mit einem eingeschränkten Blickfeld, mit totalitären Bewegungen, die wir längst überwunden glaubten? Und mit einem Krieg in Europa, den wir bis vor kurzem für unmöglich hielten?
In meinem Schreiben spielen die Folgen des Zweiten Weltkriegs eine zentrale Rolle, seine Auswirkungen auf Menschen vor dem Hintergrund von Schuld, Flucht und Vertreibung. Nun ist so vieles davon wieder zur bedrückenden unmittelbaren Gegenwart geworden.
Vor einigen Wochen hat mich in der Arte-Dokumentation „Die Überlebenden von Mariupol“ das Gesicht eines kleinen Jungen angesehen. Es war eine von vielen Geschichten, aber dieses Kind hat sich in mir festgesetzt, ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter und seiner Schwester im Theater von Mariupol die Bombardierung überlebt hat. „Sie haben uns reingelegt,“ sagt er. „Sie haben uns gesagt, dass in der Nähe vom Theater Busse auf uns warten würden. Wir sind da hingegangen, aber da waren keine Busse. Dann haben wir laute Explosionen gehört und sind weggerannt. […]. Und dann sind Steine runtergefallen […]. Wir mussten über tote Menschen rennen. So haben sie dagelegen“, sagt der Junge und lehnt seinen Oberkörper zur Seite. „Die Augen waren zu. Ich dachte, dass sie gerade sterben. Vielleicht war das so.“
Der Junge schaut dabei unentwegt in den Himmel. „Seit meine Oma gestorben ist, sitze ich oft am Fenster und schaue hoch zu den Wolken,“ sagt er. „Vielleicht streckt sie irgendwann ihren Kopf raus. Wir sollten ein Flugzeug kaufen mit einem Fenster, das man aufmachen kann. Dann könnten wir uns anfassen.“
„Du willst sie anfassen?“ fragt seine Mutter.
„Ja. Ich will sie fühlen können.“
„Meinst du, das geht?“
„Ja.“
Verstörende Sätze eines zutiefst traumatisierten Kindes. Sie lassen das privilegierte Aufwachsen in einer Gesellschaft der Nachkriegszeit, die über die Taten der Vergangenheit schwieg, verblassen. Ich wurde „in die Stille danach“ hineingeboren, für die Kinder der Ukraine, und nicht nur der Ukraine, ist der Krieg Gegenwart.
Wir sind Zeugen. Wie damit umgehen?
Erzählen davon.

Im Bild v.l.n.r.: Nino Haase (OB Landeshauptstadt Mainz), Marianne Grosse (Kulturdezernentin Landeshauptstadt Mainz), Alois Hotschnig und Dr. Norbert Himmer (Intendant ZDF). Copyright ZDF